Die vergessene Ebene: Warum Kommunen der Schlüssel zur Energiewende sind
Mit ihrem Projekt BePart – Quo vadis Beteiligung – Bewertung von Partizipation in Energieprojekten liefern Dr. Franziska Mey und Benita Ebersbach vom RIFS Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit am GFZ neue, quantitative Erkenntnisse zu Bürger*innenbeteiligung in Energieprojekten. Im Gespräch erklären sie, warum Konflikte nicht immer negativ sind und warum Projektierer die Regionalität und den gesellschaftlichen Mehrwert stärker berücksichtigen müssen, um Kommunen langfristig mitzunehmen.
Frau Ebersbach, Frau Mey, Sie haben kürzlich Ihr Projekt BePart – „Quo vadis Beteiligung – Bewertung von Partizipation in Energieprojekten“ abgeschlossen. Worin unterscheidet sich BePart von bisherigen Studien zur Bürger*innenbeteiligung?
 Dr. Franziska Mey: Ich denke, ein großer Unterschied ist tatsächlich, und das ist so ein bisschen meinem Hintergrund geschuldet, dass ich meine Doktorarbeit im Bereich der Bürgerenergie gemacht habe und sehr viele Fallbeispiele zu den Vorteilen der Beteiligung quasi über diese Bürgerenergieforschung kennengelernt habe. In diesem Zusammenhang ist mir aufgefallen, dass es schon zahlreiche Studien und dementsprechend ein sehr umfangreiches Material zur Bürgerenergie oder Community Energy gibt.
Dr. Franziska Mey: Ich denke, ein großer Unterschied ist tatsächlich, und das ist so ein bisschen meinem Hintergrund geschuldet, dass ich meine Doktorarbeit im Bereich der Bürgerenergie gemacht habe und sehr viele Fallbeispiele zu den Vorteilen der Beteiligung quasi über diese Bürgerenergieforschung kennengelernt habe. In diesem Zusammenhang ist mir aufgefallen, dass es schon zahlreiche Studien und dementsprechend ein sehr umfangreiches Material zur Bürgerenergie oder Community Energy gibt.
Was bisher gefehlt hat beziehungsweise auch in der Literatur dazu angemerkt wurde, ist, dass es sich eher um qualitative Untersuchungen handelt, die oft speziell den Bürgerenergiesektor in den Fokus nehmen, statt um quantitative Untersuchungen, die ein breiteres Spektrum abdecken. Wie wirkt Beteiligung tatsächlich? Wie lässt sie sich evaluieren? Dieser Herausforderung wollten wir uns in unserem Projekt stellen. Und das ist uns vor allem für eine Betrachtung von Gesamtdeutschland tatsächlich gelungen.
Benita Ebersbach: Unser Anspruch war auch, Projekte, die von größeren Projektentwicklern initiiert wurden, mit in die Stichprobe aufzunehmen. Darüber hinaus gibt es viele Studien, die sich auf finanzielle Beteiligung fokussieren. Wir haben alle potenziellen Beteiligungsformate erfasst und jeweils versucht, eine Wirkung dieser abzuleiten.
Zu welchen Ergebnissen ist Ihr Projekt gekommen?
Dr. Franziska Mey: Eine der großen Erkenntnisse war, dass mehr Beteiligung keinen wirklichen Einfluss auf die Geschwindigkeit der Umsetzung eines Projektes hat. Tatsächlich wirken sich eher die Integration von Stakeholdern vor Ort und die Einbindung von Ehrenamtlichen mit ihrer kommunikativen Unterstützung positiv auf die Geschwindigkeit eines Projekts aus.
Unsere Untersuchungen zeigen zudem, dass es einen Zusammenhang zwischen bestehenden Konflikten und Beteiligungsmaßnahmen gibt. Aber in der Retrospektive ist es schwer nachzuvollziehen, welches Ereignis zuerst kam. In vielen Fällen haben Konflikte dazu geführt, dass mehr Beteiligung stattgefunden hat. Gleichzeitig haben wir aber auch erlebt, dass Beteiligungsangebote, vor allem finanzielle, in manchen Situationen Konflikte verstärken können – zum Beispiel, wenn sie als ungerecht empfunden werden, weil nur wenige profitieren, oder als Versuch, Gegner*innen zu beeinflussen. Insgesamt lässt sich sagen, dass finanzielle Beteiligung allein nur begrenzt dazu geeignet ist, festgefahrene Konflikte zu lösen.
Und die Beteiligung dient dazu, die Kommunen mitzunehmen und damit quasi das Feld in Anführungsstrichen für neue Projekte in der Region zu bereiten. Ein wichtiger Schritt, um die Energiewende langfristig auf solide Füße zu stellen. Man sollte als Projektierer, wenn man den Ort verlässt, keine verbrannte Erde hinterlassen. Vielmehr ist es notwendig, gute Verbindungen, gute Netzwerke aufzubauen und einen gewissen Beitrag für die lokale Wirtschaft, die regionale Entwicklung, zu leisten.
Was hat Sie während Ihrer Projektzeit am meisten überrascht?
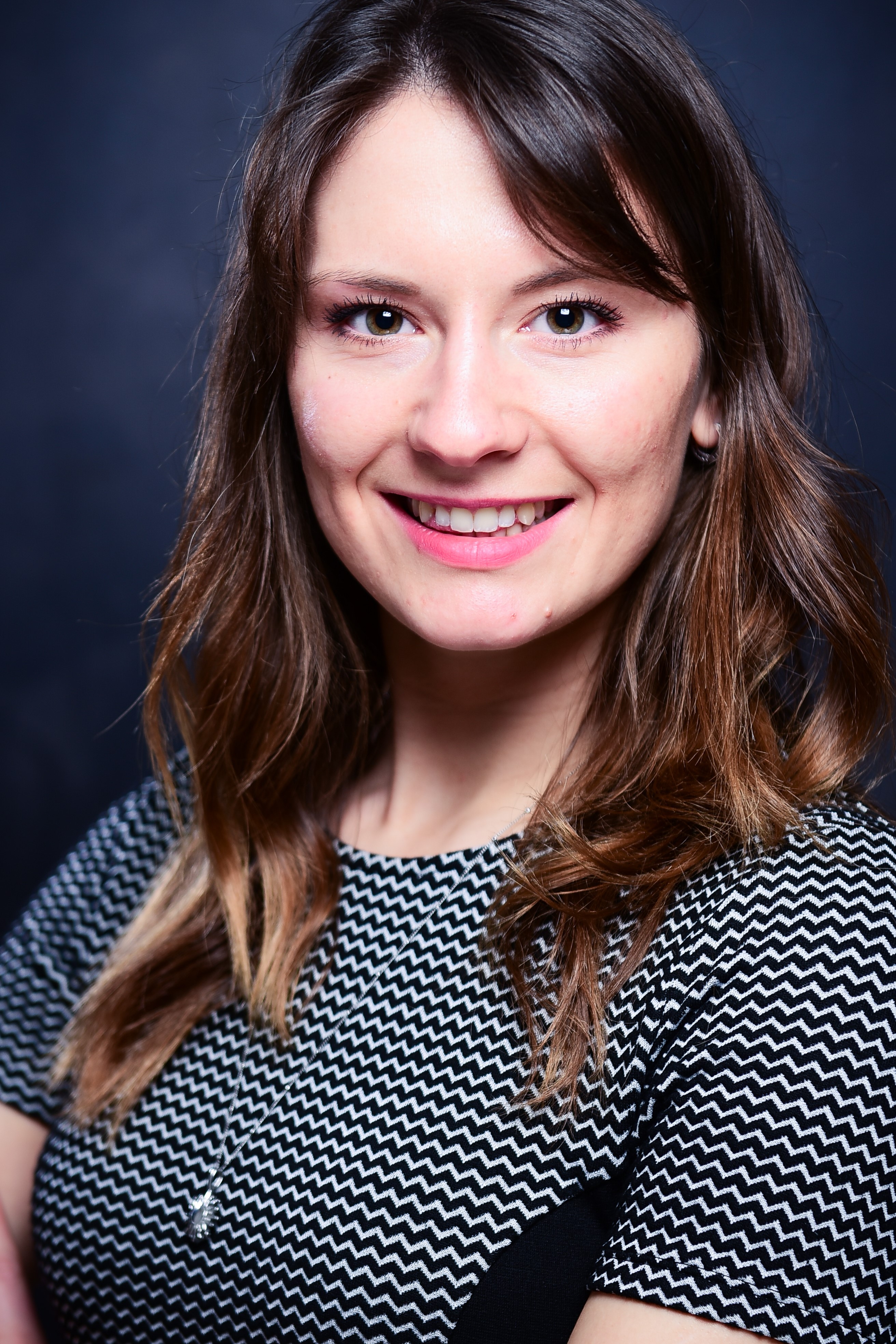 Benita Ebersbach: Was uns außerdem überrascht hat, ist, dass auch in Projekten mit Konflikten vielfältige Beteiligungsformate zu finden waren. Also entgegen unserer Annahme, dass Beteiligung direkt konfliktvermeidend wirkt, sehen wir erstmal grundsätzlich, dass das beides häufig gemeinsam auftritt. Hier stellt sich natürlich die große Frage: Was kommt zuerst? Und unsere qualitativen Analysen können da zumindest bei finanzieller Beteiligung jenes Bild zeigen, dass eben finanzielle Beteiligung häufiger als konfliktlösendes Format eingesetzt wurde. Allerdings scheint finanzielle Beteiligung an sich kein Allheilmittel zu sein, aber je nach Kontext kann es ein wichtiger Hebel sein.
Benita Ebersbach: Was uns außerdem überrascht hat, ist, dass auch in Projekten mit Konflikten vielfältige Beteiligungsformate zu finden waren. Also entgegen unserer Annahme, dass Beteiligung direkt konfliktvermeidend wirkt, sehen wir erstmal grundsätzlich, dass das beides häufig gemeinsam auftritt. Hier stellt sich natürlich die große Frage: Was kommt zuerst? Und unsere qualitativen Analysen können da zumindest bei finanzieller Beteiligung jenes Bild zeigen, dass eben finanzielle Beteiligung häufiger als konfliktlösendes Format eingesetzt wurde. Allerdings scheint finanzielle Beteiligung an sich kein Allheilmittel zu sein, aber je nach Kontext kann es ein wichtiger Hebel sein.
Spannend war auch die unterschiedliche Sichtweise der Gemeinden und Projektierer, als wir sie gefragt haben, was sie als ausschlaggebende Punkte für die Wahrscheinlichkeit von weiteren Projekten in der Region ansehen. Vor allem Gemeinden betonten: Je mehr Beteiligung durchgeführt wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für weitere Projekte in der Region. Projektbetreiber scheinen diesen Zusammenhang noch nicht so wahrzunehmen. Sie sehen eher Einschätzungen zur Windhöffigkeit oder weitere geeignete Flächen als entscheidend dafür an, dass die Wahrscheinlichkeit von Folgeprojekten in einer Region steigt.
Dr. Franziska Mey: Für mich war es auch der Aspekt, zu sehen, dass Konflikte nicht immer zwingend als etwas Negatives wahrgenommen werden. Natürlich gibt es eine Reibung vor Ort, aber die Reibung erfolgt wahrscheinlich auch aus guten Gründen und dies ist erst einmal anzuerkennen. Also erst mal einen Schritt zurücktreten und sehen, was denn die unterschiedlichen Argumente und Bedürfnisse sind, die auf den Tisch gelegt werden. Wenn man im Gespräch bleibt, kommt man häufig zu Lösungen und so können eben angepasste Beteiligungsmaßnahmen einen Mehrwert bieten beziehungsweise den Raum zur Gestaltung wieder öffnen.
Sie sprechen in Ihrem Bericht auch vom Beteiligungsparadoxon: Je weiter Projekte fortgeschritten sind, desto größer wird das Bedürfnis nach Mitwirkung, doch desto kleiner werden die Spielräume für Einfluss. Kann dieses Paradoxon aufgelöst werden?
Benita Ebersbach: Warum ist das überhaupt so? Vieles begründet sich in der zeitlichen und manchmal auch räumlichen Distanz eines Projektes. Dass uns das Thema Klimawandel angeht, wissen wir und dennoch gibt es das schwierige Momentum der psychologischen Distanz. Diese trägt dazu bei, dass man sich erstmal da nicht betroffen fühlt, das Problem wird noch in weiter Zukunft wahrgenommen. Nun geht es also darum, diese Distanz zu verringern, damit man frühzeitig Interesse daran hat, dass da etwas passieren wird, oder man sich betroffen fühlt.
Und hier kann natürlich Beteiligung eine Rolle spielen. Das muss aber nicht gleich ein ausgeklügeltes Beteiligungsformat sein, sondern zum Beispiel eben auch, dass man auf die Leute zugeht. Vielleicht nicht nur zu einer Informationsveranstaltung einladen, sondern die Menschen vor Ort aufsuchen. Beteiligung ist eine Möglichkeit, Menschen in ihrem Alltag zu erreichen, ohne von ihnen zu verlangen, irgendwo hinzukommen oder sich irgendwo anzumelden oder zu informieren.
Dr. Franziska Mey: Bei den Erneuerbaren ist eben vor allem die Projektlogik in diesem Zusammenhang die Herausforderung. Ich denke da an das mehrstufige Verfahren in Deutschland: beispielsweise die Zielsetzung auf nationaler Ebene, die Übersetzung des Ganzen auf Landesebene und anschließend die Regionalplanung mit der Ausweisung der Vorranggebiete. Bis klar ist, welche Gemeinde oder Gemeinden ausgewählt wurden, vergeht viel Zeit für einen sehr komplexen Prozess, bei dem natürlich nicht jeder Bürger und jede Bürgerin mitgenommen werden kann oder daran bereits interessiert ist. Zu diesem Zeitpunkt ist es tatsächlich sehr, wenn nicht sogar zu abstrakt. Aber sobald es im Prinzip um ein konkretes Projekt geht, denke ich, ist es natürlich gut und notwendig, wenn es eine bestimmte Flexibilität gäbe, um die Bürger*innen gleich mitzunehmen. Für Projektierer ist es jedoch in einem so fortgeschrittenen Stadium schon wieder schwieriger, weil sie bereits ein bestimmtes Stück Land gesichert haben. Dann noch weiter nach links oder rechts oder an den nächsten Ort heranzugehen, ist schwierig.
Benita Ebersbach: Was dem Problem, von einem Prozess aufgrund der geschilderten Aspekte überrannt zu werden, entgegenwirken könnte, wäre, dass eine Gemeinde oder Stadt selbst vorab bereits für ihr Gemeinde-/Stadtgebiet proaktiv eine Vision zum Beispiel zu einer erneuerbaren Energieversorgung entwickelt und das bestmöglich natürlich partizipativ mit ihren Bürger*innen. Aber nichtsdestotrotz werden auch zu diesen Beteiligungsformaten natürlich nur Menschen kommen, die sich dafür interessieren und die Zeit haben. Das ist ja tatsächlich häufig nicht die Mehrheit, leider.
In Ihrem neuen Projekt „Potenziale kommunaler finanzieller Beteiligung beim Ausbau erneuerbarer Energien“ soll gezeigt werden, wie durch kommunale finanzielle Beteiligung gewonnene Einnahmen zielgerichtet eingesetzt werden können und welche tatsächliche Wirkung sie entfalten können. Wie können die Erkenntnisse aus BePart hier genutzt werden?
Dr. Franziska Mey: Unser neues Projekt „Potenziale kommunaler finanzieller Beteiligung beim Ausbau erneuerbarer Energien (KomFi)“, in dem wir ja auch mit Euch zusammenarbeiten, kann im Prinzip dank BePart auf eine sehr gute, umfangreiche Datengrundlage zu verschiedenen Einsichten gegenüber finanzieller Beteiligung zurückgreifen.
Die große Frage für uns ist nun, wie die Gemeinden die finanzielle Beteiligung nutzen, um einen Mehrwert zu schaffen und die Unterstützung der lokalen Bevölkerung für solche und zukünftige Projekte zu erhalten. Schaffen wir das überhaupt? Ist das überhaupt etwas, was die Leute als solches schon wahrnehmen? Wie wird darüber kommuniziert? Oder, was mir ja vorhin schon angedeutet wurde, wird eine Art Bestechung wahrgenommen.
Benita Ebersbach: Ich sehe da BePart auch als Türöffner, weil wir leider nicht die Möglichkeit hatten, so wirklich richtig in die Tiefe zu gehen und in die Qualität der einzelnen Beteiligungsformate einzusteigen, sondern unser Fokus eher darauf lag, erst einmal über alle Formate hinweg Tendenzen oder Einflüsse wahrzunehmen. Deshalb bin ich sehr gespannt darauf, jetzt wirklich detailliert zu schauen, wie die finanzielle Beteiligung von den Gemeinden oder Städten verwendet wird. Wie die finanzielle Beteiligung zum Gelingen beitragen oder vielleicht eben auch Konflikte verschärfen kann. Welcher Kommune gelingt es, mit den Geldern entsprechend die gewünschte Außenwirkung zu erzeugen?
Da muss ich tatsächlich an die Betreiber der Atomkraftwerke denken. Diese haben ja in den Gemeinden ganze Schulen und Krankenhäuser gebaut, um den Widerstand in der Bevölkerung zu schmälern oder gar nicht erst richtig aufflammen zu lassen. Können und müssen wir da vielleicht auch ein bisschen von der Herangehensweise dieser lernen?
Dr. Franziska Mey: Auch Kohlekraftwerke bzw. die Kohleminen im Ruhrgebiet haben im Prinzip kulturelle Unterstützung geleistet, haben lokale Vereine unterstützt. Wenn auch vor einem anderen Hintergrund sehe ich bis zu einem gewissen Grad die Projektierer in der Verantwortung, wie damals auch einen gesellschaftlichen Mehrwert zu leisten.
Sie werden sicherlich aufgrund ihrer geringeren Margen im Vergleich zu einem AKW kein Krankenhaus bauen können. Aber es muss klar sein, dass in der Region etwas hängen bleibt und dass die Region tatsächlich einen Mehrwert davon hat, eine solche Infrastruktur vor Ort zuzulassen. Das kann beispielsweise heißen, dass der Projektierer im Sommer allen Kindern aus dem Ort den Freibadeintritt bezahlt etc. Ich denke, dass sie das damals im Prinzip clever gemacht haben. Es war auch notwendig und ist es heute ebenso. Es reicht eben nicht mehr, nur mit dem Klimaschutz zu kommen. Es reicht nicht, nur zu sagen: „Wir sorgen jetzt hier für saubere Luft“ oder „Wir sorgen dafür, dass quasi Kohlekraftwerke abgeschaltet werden, weil wir jetzt hier Energie produzieren und diese grün ist“.
Und noch ein Gedanke zum Mehrwert. Was auch ganz anders als bei einem Atomkraftwerk oder einem Kohlekraftwerk ist: Die Arbeitsplätze, die über Wind oder Solar in einer Region geschaffen werden, sind eben auch viel, viel, viel geringer. Hier wohnt nicht eine große Belegschaft direkt vor Ort. Es muss einen Mechanismus geben, der der Bevölkerung vor Ort zeigt: Es bleibt etwas hängen. Und die Leute müssen ernst genommen werden mit ihren Bedenken und Eingebungen.
Benita Ebersbach: Es gibt ja auch schon viele Beispiele, sei es durch Sponsoring oder eben einen Gemeindefonds, in den Projektbetreibende einzahlen, um gemeinnützige Projekte zu finanzieren. Es gibt die Instrumente für einen solchen Mehrwert, wir sollten nur das Bewusstsein schärfen, auch auf sie zurückzugreifen.
Und in der Forschung wird es auch unterschiedlich diskutiert, welche Maßnahmen denn nun mehr Akzeptanz bringen. Sei es einerseits die individuellen Erstattungen oder Zahlungen für das Kollektiv, für die Gemeinschaft. Ich bin gespannt, was KomFi uns hier möglicherweise aufzeigen wird.
Es ist wahrscheinlich auch ein Unterschied, ob mit diesen Geldern Schulden abgebaut werden oder etwas Sichtbares geschaffen wird.
Dr. Franziska Mey: Ja, oder Gemeinden sagen: Wir bauen Schulden ab und haben dann in fünf Jahren keine Schulden mehr und können wir uns dann im Prinzip wieder neuen gemeinnützigen Projekten widmen. Es ist einfach auch die Frage, wie die Gemeinde mit dem Schuldenabbau durch Erneuerbare umgeht, wie sie es kommuniziert. Denn Schuldenabbau ist wirklich wichtig und wesentlich, um überhaupt die Gemeinden wieder handlungsfähig zu machen.
Ein von Ihnen in der BePart-Studie herausgehobener Aspekt der Beteiligung ist die Regionalität. So müssen die Akteur*innen vor Ort die Möglichkeit haben, ein für die Region, in der das Projekt umgesetzt wird, ein geeignetes Beteiligungsmodell zu entwickeln. Viele kleinere Kommunen haben weder Personal noch Erfahrung, um Beteiligung professionell zu gestalten. Welche Unterstützung brauchen sie – und von wem?
Dr. Franziska Mey: Dass es diesbezüglich eine Unterversorgung gibt, beziehungsweise, dass die Gemeinden oder Kommunen mehr vom Bund unterstützt werden sollten, würde ich unterschreiben. Im Prinzip sind es die wichtigen Akteur*innen vor Ort, die die Energiewende in der Hand haben. Die unterschiedlichen Klimamanager etwa leisten einen unglaublich wichtigen Mehrwert. Diese Institution auszubauen, wäre ein wichtiger Schritt, um vor Ort mehr Präsenz und auch mehr Kapazitäten zu schaffen, um diese Projekte entsprechend in der Wahrnehmung angemessen hervorzuheben und positiv konnotieren zu lassen. Dann können die Bürger*innen mit jemanden in der Gemeinde tatsächlich auch sprechen. Jemand, der oder die vor Ort ist, sei es beim Bäcker oder im Supermarkt.
Das sind wichtige Elemente, die vielerorts nicht vorhanden sind und wo es wirklich nottut, noch einmal draufzuschauen: sowohl aus nationaler als auch aus Länderperspektive. Denn nur Ziele von oben vorzugeben und nicht den Unterbau zu stärken, ist nicht zielführend.
Benita Ebersbach: Wie wichtig so eine Anlaufstelle vor Ort sein kann, zeigt beispielsweise Steinfurt. Hier gibt es eine Service-Stelle für Windenergie – eine Anlaufstelle für Gemeinden und interessierte Bürger*innen.
Natürlich gibt es auch immer mehr unabhängige Organisationen, die solche Prozesse vor Ort mit begleiten und unterstützen, die die Moderation übernehmen und auch Beteiligungsmaßnahmen durchführen, aber die müssen natürlich extern beauftragt werden und das scheitert meistens auch wieder an der Finanzierung.

Social Media