Mythos #8: Sind Kernfusion und Mini-Reaktoren die Zukunft?
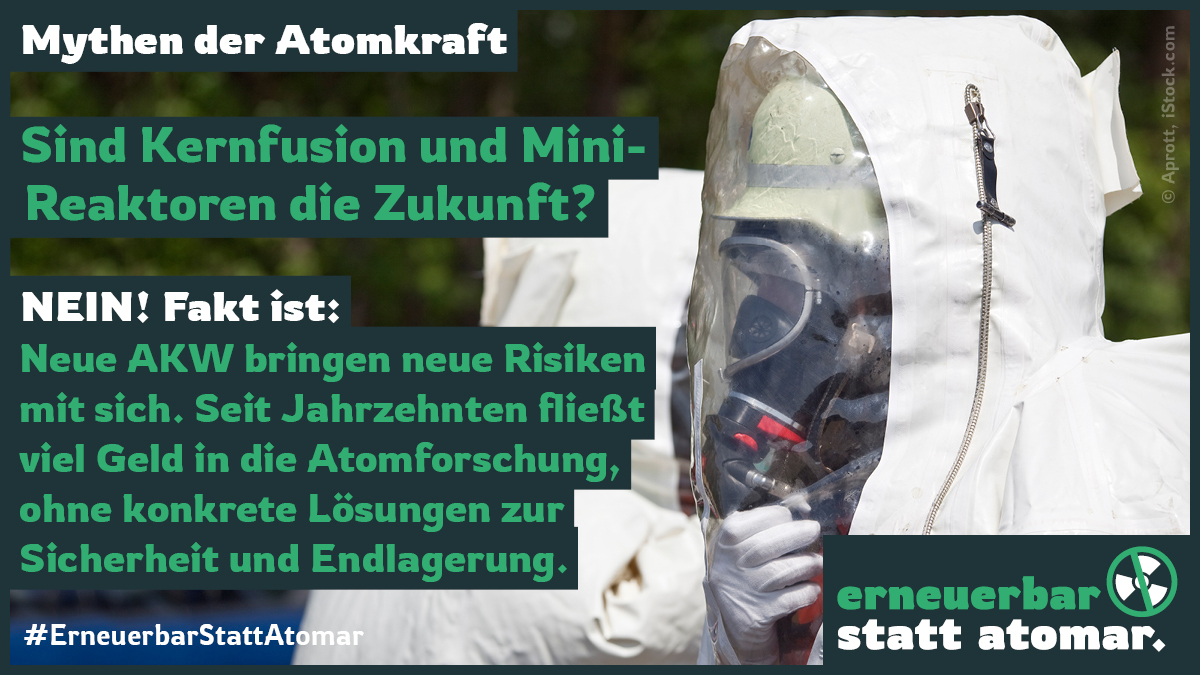 Nein! Fakt ist: Der technologische Durchbruch bei der Kernfusion ist noch immer ungewiss. Mit einem kommerziellen Betrieb von kleinen Atomreaktoren (SMR) wird frühestens ab 2030 gerechnet und er hängt von massiver staatlicher Förderung ab. Zudem bringen neue Atomkraftwerke neue Risiken mit sich. Seit Jahrzehnten fließt viel Geld in die Atomforschung, ohne insbesondere die Frage einer sicheren Endlagerung geklärt zu haben.
Nein! Fakt ist: Der technologische Durchbruch bei der Kernfusion ist noch immer ungewiss. Mit einem kommerziellen Betrieb von kleinen Atomreaktoren (SMR) wird frühestens ab 2030 gerechnet und er hängt von massiver staatlicher Förderung ab. Zudem bringen neue Atomkraftwerke neue Risiken mit sich. Seit Jahrzehnten fließt viel Geld in die Atomforschung, ohne insbesondere die Frage einer sicheren Endlagerung geklärt zu haben.
WDer Traum von der unendlich verfügbaren, klimaneutralen Energiequelle befeuert die Forschung zur Kernfusion schon seit etwa 50 Jahren. In Europa gibt es zwei Projekte, JET in England und ITER in Südfrankreich. Der Fusionsreaktor ITER ist schon seit über 30 Jahren in Planung, seit 2008 im Bau und soll 2035 in den Demonstrationsbetrieb gehen. Ein kommerzieller Betrieb von Kernfusionsreaktoren ist mindestens in weiter Ferne, wenn es überhaupt gelingt. Im Dezember 2024 hat das Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) eine Studie zum aktuellen Stand und Perspektiven der Kernfusion veröffentlicht. Demnach sind noch viele Fragen ungewiss. Dazu gehört die Materialentwicklung, da Fusionsreaktoren besondere Ansprüche an die verwendeten Materialien stellen. Daneben stellt sich die Frage, ob ausreichend Rohstoffe zur Verfügung stehen, denn die Technologie braucht sehr seltene und spezielle Rohstoffe wie Tritium, Helium, Beryllium und Lithium. Zu welchen Kosten Fusionsreaktoren Energie bereitstellen können, ist bislang völlig unklar. Ohne massive staatliche Förderung wird es jedenfalls nicht gehen und mit relevanten Kostendegressionen rechnet das TAB nicht. Knackpunkt für einen konstruktiven und relevanten Beitrag für den Klimaschutz ist neben der zeitlichen Perspektive auch die Integration in ein weitgehend durch Erneuerbare Energien geprägtes Energiesystem. Zur Ergänzung von Wind und Sonnenenergie werden eigentlich schnell und flexibel regelbare Anlagen mit geringen Investitionskosten benötigt. Das ist bei der Kernfusion genauso wenig gegeben wie bei herkömmlichen Atomkraftwerken. Die Schwierigkeiten und Herausforderungen der Kernfusion schildert auch Jörg Müller, Vorstandsvorsitzender der ENERTRAG SE, in unserem Video-Interview.
Das Konzept der kleinen modularen Reaktoren (Small Modular Reactors, SMR) ist nicht wirklich neu. In der Vergangenheit hat man sich aus Sicherheitsgründen dafür entschieden, lieber auf eine geringere Anzahl großer Atomkraftwerke zu setzen. Der Physiker Harald Lesch schildert anschaulich Vor- und Nachteile der SMR und kommt zu dem Schluss: „Diese Form von Rettung gegen den Klimawandel läuft Gefahr vom Klimawandel überholt zu werden”. Eine erst im Januar 2025 veröffentlichte Studie der Internationalen Energie-Agentur (IEA) schwärmt zwar von den Chancen einer neuen Ära der Nuklearenergie durch SMR, bei näherer Betrachtung werden jedoch viele Bedingungen und Voraussetzungen genannt, damit daraus tatsächlich eine erfolgversprechende Perspektive entsteht. Dazu gehören insbesondere „fortgesetzte Innovation, ausreichend staatliche Unterstützung und neue Geschäftsmodelle“. Hervorgehoben wird an verschiedenen Stellen die zentrale Frage der Finanzierung. Mit einem kommerziellen Betrieb erster SMR rechnet die IEA frühestens 2030, der weitere Erfolg hänge dann von Kostendegressionen ab. Wenn alles gut laufe, könnten SMR im Jahr 2040 etwa 10 Prozent der insgesamt installierten Atomkraft-Kapazität ausmachen. Allerdings benennt die IEA auch relevante Risikofaktoren. Dazu gehören insbesondere die starke Marktkonzentration bei den Nukleartechnologien (insbesondere Russland und China), genauso wie bei der Uranförderung und -anreicherung.
Weltweit, auch in Deutschland, fließen weiterhin umfangreiche staatliche Mittel in die Erforschung der Atomenergie. Die Mitgliedstaaten der Internationalen Energieagentur IEA steckten von 1974 bis 2019 fast 300 Milliarden US-Dollar in die Kernenergieforschung, während die staatlichen Forschungsausgaben für Erneuerbare Energien lediglich 80 Milliarden US-Dollar betrugen. Zwar ist der Anteil der F&E-Ausgaben für die Atomenergie an der gesamten Energieforschung im Lauf der Zeit gesunken, lag jedoch im Jahr 2019 immer noch bei 21 Prozent und damit sechs Prozentpunkte höher als die Forschungsausgaben für Erneuerbare Energien. Das Missverhältnis der Ausgaben zeigt sich besonders an der installierten Kraftwerksleistung. Seit 1974 gingen jährlich im Mittel 4,7 Gigawatt Atomkraft an den Start, während allein im Jahr 2023 eine Stromerzeugungskapazität von 473 Gigawatt Erneuerbaren Energien neu installiert wurde.
In Europa erfolgt eine Zusammenarbeit und Koordinierung der Atomforschung im Rahmen von Euratom, der Europäischen Atomgemeinschaft. Euratom wurde 1957 gegründet und hat die Aufgabe, die zivile Atomwirtschaft in der EU zu kontrollieren und die Kernforschung und -technik zu fördern. Der Euratom-Vertrag soll die Forschungsprogramme der Staaten für die Nutzung der Kernenergie koordinieren und dazu beitragen, dass Wissen und Infrastrukturen gemeinsam genutzt werden. Er verpflichtet die Mitgliedsstaaten auch, die entsprechenden Finanzmittel bereitzustellen. Angesichts der Risiken der Atomenergie stehen vor allem Sicherheitsfragen bzw. der Gesundheitsschutz im Fokus.
In Deutschland konzentriert sich die Nuklearforschung heute auf die Gebiete Reaktorsicherheit, Zwischenlagerung und Behandlung hochradioaktiver Abfälle, Endlagerung sowie Strahlenforschung. Von den insgesamt knapp 1,5 Milliarden Euro, die die Bundesregierung im Jahr 2023 für die Energieforschung ausweist, entfallen rund 51 Millionen Euro auf Forschungsprojekte im Bereich Reaktorsicherheit sowie 72 Millionen Euro auf institutionelle Förderung in den Bereichen nukleare Entsorgung, Sicherheit und Strahlenforschung sowie Kernfusion.

Social Media