Urbane Wärmewende im Fokus: Rostock und Wuppertal im Austausch zur klimaneutralen Wärmeversorgung
Rostock, die Hansestadt an der Ostsee, trifft auf Wuppertal, das Industrie- und Kulturzentrum im Bergischen Land. Zwei Großstädte mit ganz unterschiedlichen historischen Wurzeln und geografischen Voraussetzungen, aber einem gemeinsamen Ziel: die Transformation hin zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung.
Im Rahmen des Projekts Forum Synergiewende kamen bei dem Kommunen-Matching Vertreter beider Städte zusammen, um sich über Erfahrungen, Herausforderungen und Lösungsansätze bei der Umstellung auf Erneuerbare Energien auszutauschen. Ziel des Formats ist es, Kommunen miteinander ins Gespräch zu bringen, voneinander zu lernen und Synergien für die kommunale Wärmewende zu nutzen.
Den Austausch eröffnete Prof. Winfried Osthorst von der Hochschule Bremen mit einem Vortrag zur Entwicklung eines kalten Nahwärmenetz in Bremen und die zentrale Rolle der Bürgerenergiegemeinschaft hierbei. Bürgerenergiegemeinschaften sind nicht nur wichtige Akteure der urbanen Wärmewende, sondern auch Ausdruck demokratischer Mitwirkung.
In Bremen gelang es der Energiegemeinschaft, breite Teile der Bevölkerung zu mobilisieren. Das große gesellschaftliche Interesse an dem Nahwärmenetz liegt unter anderem daran, dass sich Bürgerenergiegemeinschaften nach dem Interesse der Menschen vor Ort richten und nicht aus der Wärmeplanung hervorgehen. Umfangreiche Unterstützung und Förderung erhält das Projekt durch die Stadt und die Klimaschutzagentur. Deutlich wird dabei die Bedeutung einer zentralen Ansprechperson in der Kommune, die als Schnittstelle zwischen der Energiegemeinschaft und der Verwaltung fungiert und die kommunalen Prozesse bündelt: eine Rolle, die auch fachlich gut aufgestellt sein muss. Diese entlastet die Energiegemeinschaft enorm und unterstützt die Planung des Nahwärmenetzes somit entscheidend. Denn Energiegemeinschaften stehen grundsätzlich vor denselben Herausforderungen wie kommunale oder private Wärmeversorger, etwa dem begrenzten Raum oder hohen Investitionskosten. Hinzukommen spezifische Hürden wie bei der Eintragung als Genossenschaft oder bei regulatorischen Anforderungen. Energiegemeinschaften stellen jedoch eine große Chance für die Wärme- und Energiewende dar: Sie setzen wichtige Projekte mit hohem Investitionsvolumen um und können somit ein wichtiger Baustein der kommunalen Wärmewende sein. Neben einem langen Atem bedarf es daher einer breiten Unterstützung durch die Kommune und andere lokale Akteure. Denn Herr Osthorst sieht vor allem den kostenintensiven und aufwendigen Bau von Wärmenetzen als große Herausforderung der Wärmewende. Der Anschluss einer erneuerbaren Wärmequelle ist dann im Vergleich kein Problem.
Im Anschluss stellte die Stadt Rostock ihre Wärmeversorgung und ihre Strategien zur Wärmewende vor. Bereits 2022 hat die Hansestadt ihren kommunalen Wärmeplan beschlossen – mit dem klaren Ziel, bis 2035 klimaneutral zu sein. Ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg war die Inbetriebnahme der Power-to-Heat-Anlage im selben Jahr. Diese nutzt überschüssigen Strom aus den Wind- und Solaranlagen und wandelt ihn in Wärme um. Ergänzt wird die Anlage durch einen naheliegenden Wärmespeicher, der 45 Millionen Liter Heißwasser speichern kann und somit Angebot und Nachfrage der Wärme flexibilisiert. Beide Anlagen werden von den Stadtwerken Rostock betrieben und leisten einen entscheidenden Beitrag zur CO2-Reduktion. Die Wärme wird über die Wärmenetze in der Stadt verteilt. Eine Besonderheit Rostocks: Die Stadt ist bereits weiträumig mit Wärmenetzen erschlossen, rund 60 Prozent der Wärme wird über Fernwärme gedeckt. Der vergleichsweise hohe Anteil ist historisch bedingt. In der DDR wurden viele neu erbaute Siedlungen direkt an ein Fernwärmenetz angeschlossen. Der Fokus in Rostock liegt daher weniger auf dem Ausbau der Wärmenetze als auf der Dekarbonisierung der Fernwärme. Aktuell speist ein Kohlekraftwerk durch unvermeidbare Abwärme einen Großteil der Fernwärme ein, ergänzt wird es durch eine modernisierte KWK-Anlage, welche mit Erdgas betrieben wird. Um die CO2-Belastung signifikant zu senken, plant die Stadt verschiedene Maßnahmen. Eine Abwasserwärmepumpe soll künftig rund ein Viertel der Fernwärme bereitstellen, die Förderung wurde bereits genehmigt. Mit dem erheblichen Stromüberschuss – Rostock erzeugt etwa sieben Mal so viel Strom wie verbraucht wird – liegt ein großes Potenzial für eine klimaneutrale Wärmeversorgung in der Sektorenkopplung.
Windenergieanlagen müssen derzeit häufig abgeregelt werden, künftig soll der Überschussstrom zur Wasserstoffproduktion genutzt werden. Das ist auch für die Wärmeversorgung relevant, denn bei der Herstellung des Gases entsteht Abwärme, die mit 50 bis 60 Grad Celsius in die Netze eingespeist werden kann. Aufgrund der freien Flächen ist die Umgebung auch ein geeigneter Standort für Rechenzentren, auch diese könnten künftig ein großes Abwärmepotenzial bieten. Ein weiterer relevanter Baustein der Wärmewende ist die Wärmespeicherung, insbesondere in Hinblick auf die saisonale Nutzung. Geplant sind sogenannte Erdbeckenspeicher mit Beteiligungsmöglichkeiten für Bürger*innen. Hierzu gibt es bereits positive Erfahrungsberichte aus vergleichbaren Projekten.
Im Vergleich zur hohen Fernwärmeabdeckung in Rostock stellt der Bau von Wärmenetzen Wuppertal vor eine größere Herausforderung. Aktuell stammen dort neun Prozent der Wärme aus Fernwärme, die vollständig mit der Abwärme einer Müllverbrennungsanlage gespeist wird. Ein zentrales Hemmnis ist die Topografie der Stadt. Das hügelige Gelände erschwert die Fernwärmeversorgung, insbesondere in höher gelegene Stadtteile. Am sogenannten Ölberg wird daher aktuell über Quartiers- und Insellösungen diskutiert. Auch die hohe Bebauungsdichte in der Stadt erschwert den Aufbau von Wärmenetzen. Baustellen dauern oft lange, verzögern den Verkehr und erzeugen damit zum Teil auch Unmut in der Bevölkerung.
Vor diesem Hintergrund rückt die Beteiligung und Kommunikation mit Bürger*innen und Stakeholdern auch immer wieder in den Fokus des Austauschs. Beide Kommunen sind sich einig: Kommunikation und Koordination werden im Kontext der Wärmewende häufig unterschätzt. Damit Wärme- und Energiewendeprojekte im Allgemeinen gelingen, müssen alle relevanten Stakeholder eingebunden werden. Die Koordination innerhalb der Verwaltung sowie unter anderem mit Stadtwerken und Bürger*innen ist umfangreich. Regelmäßige Termine z. B. mit den Stadtwerken erwiesen sich als hilfreich, um die Abstimmung und den Projektverlauf insgesamt zu verbessern. Wärmeprojekte können zudem effizienter realisiert werden, wenn sie in bestehende Austauschformate eingebunden und mit anderen Vorhaben kombiniert werden. Aber auch andere Akteure, die häufig nicht mitgedacht werden, wie Handwerker*innen oder Schornsteinfeger*innen müssen verstärkt in die Planung einbezogen werden. Als direkte Ansprechpersonen sind sie im täglichen Kontakt mit Bürger*innen und leisten Beratung vor Ort. Wenn Handwerker*innen nicht hinter der Energiewende stehen, wird es daher auch schwer Bürger*innen von Erneuerbaren Energien zu überzeugen. Wuppertal hat in diesem Kontext gute Erfahrungen mit der Initiierung eines Expertenrats zur Wärmeplanung gemacht, in dem auch Handwerker*innen vertreten waren. So können unterschiedliche Perspektiven zusammengeführt und Lösungen erarbeitet werden, die breit getragen und umgesetzt werden. Auch in Rostock wurde ein Wärmerat gegründet, zu dem alle wichtigen Akteure zwei Mal pro Jahr zusammenkommen sollen.
Ein weiterer zentraler Punkt der Wärmewende ist es, Bürger*innen umfangreich zu informieren und einzubinden. Maßnahmen wie Baustellen, können den Alltag deutlich beeinträchtigen und werden oft als störend empfunden, sodass als Folge auch die Energiewende insgesamt kritisch gesehen werden kann. Um dem entgegenzuwirken, ist es entscheidend, solche Projekte nicht abstrakt oder vage zu kommunizieren, sondern frühzeitig, konkret und nachvollziehbar zu erklären und ggf. auch die Vorteile für die einzelnen Haushalte darzulegen. Dies gilt insbesondere auch in Phasen, in denen neue Wärmenetze entstehen und Bürger*innen möglichst überzeugt werden sollen, sich anzuschließen. Dabei spielt auch die Wahl der Kommunikationskanäle eine wichtige Rolle. Neben der offiziellen Website der Kommune können soziale Medien die Zielgruppen erweitern. Auch Anlaufstellen vor Ort, bei denen Leute sich bei Fragen oder Interesse informieren können, sind hilfreich – in der Praxis lässt sich das jedoch nur schwer umsetzen. Bei dem Austausch sind sich alle einig: Wichtiger als Perfektion ist der erste Schritt. Oft wird lange geplant und optimiert. Doch es zeigt sich, wer beginnt, schafft Raum für Entwicklung.
Vielen Dank für den offenen und inspirierenden Austausch und weiterhin viel Erfolg auf dem Weg zur klimaneutralen Wärmeversorgung.
Der kommunale Austausch wurde im Rahmen des Projekts "Forum
Synergiewende" durchgeführt. Das Projekt wird vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Klimaschutz im Rahmen der Nationalen
Klimaschutzinitiative (NKI) gefördert, und von der Agentur für
Erneuerbare Energien (AEE) und der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gemeinsam
durchgeführt. Weitere Informationen zum Projekt erhalten Sie hier.


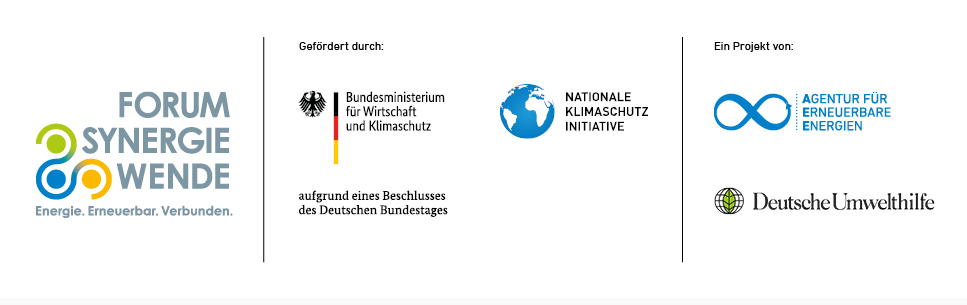
Social Media