Kommunen im Schulterschluss: Stadt Bruchsal und Landkreis Ebersberg tauschen sich über ihre Erfahrungen in der kommunalen Wärmewende aus
Wie gelingt es Kommunen, die Energiewende noch stärker voranzutreiben und die Wärmeversorgung vor Ort auf erneuerbare Energieträger umzustellen? Um diese Fragen drehte sich der Erfahrungsaustausch zwischen der Stadt Bruchsal und dem Landkreis Ebersberg. Beide Kommunen setzen sich für eine klimafreundliche Zukunft ein – mit verschiedenen Maßnahmen zur Reduzierung fossiler Energien und der Initiierung innovativer Sektorenkopplungsprojekte.
Während Strom bereits mehrheitlich durch Erneuerbare Energien erzeugt wird, schreitet die Dekarbonisierung des Verkehrs und im Wärmesektor nur schleppend voran. Als zentales Element für den Umbau des gesamten Energiesystems gilt Sektorenkopplung. Strom aus Erneuerbaren Energien wird im Rahmen der Sektorenkopplung verstärkt im Wärme-, Industrie- und Verkehrssektor genutzt, z.B. durch Wärmepumpen und Elektromobilität. Die Wärmewende stellt Kommunen jedoch vor große Herausforderungen. Begrenzte personelle Ressourcen und knappe finanzielle Mittel schränken Handlungsspielräume ein, erfordern Motivation und Veränderungswillen. Gleichzeitig zeigen viele Kommunen, wie wirkungsvolle Lösungen umgesetzt und Fortschritte erzielt werden können. Ihre Erfahrungen aus der Praxis geben wertvolle Impulse für die Zukunft sowie für andere Kommunen.
Eine dieser Vorreiterkommunen ist das baden-württembergische Bruchsal. Ziel der 47.000 Einwohner*innen-Stadt ist es, bis 2040 klimaneutral zu werden. Aus der engen Zusammenarbeit zwischen Stadt und Stadtwerken sind verschiedene Projekte hervorgegangen, mit denen eine CO2-neutrale Strom- und Wärmeerzeugung angestrebt wird. Bereits mehrere Wärmenetze werden in Bruchsal überwiegend auf Basis Erneuerbarer Energien betrieben. Unter anderem eine große Solarthermieanlage und ein, mit Holzenergie betriebenes Blockheizkraftwerk, das Strom und Wärme effizient durch Kraft-Wärmekopplung erzeugt, sind in die Wärmenetze eingebunden. Im Erfahrungsaustausch mit dem Landkreis Ebersberg wurden diese Maßnahmen näher besprochen. Der oberbayrische Landkreis liegt östlich von München und weist mit 140.000 Einwohner*innen eine überdurchschnittlich hohe Bevölkerungsdichte auf. Wie vielerorts stellt sich auch hier die Frage: Wie lassen sich die Potenziale Erneuerbarer Energien für die kommunale Wärmeversorgung nutzen und Wärmenetze effizient und wirtschaftlich umsetzen?
Im Dialog zwischen Bruchsal und Ebersberg wurden zunächst Hemmnisse identifiziert, die es bei der Planung und Umsetzung von Wärmeprojekten zu berücksichtigen gilt. Die größten Herausforderungen stellen neben der Finanzierung und einer komplexen Förderlandschaft, auch Bürokratie, Personal und zeitliche Abläufe dar. Mit den Erfahrungswerten aus Bruchsal wurden anschließend gemeinsam Lösungsansätze erarbeitet: Entscheidend ist es, im ersten Schritt die Entscheidungsträger*innen mitzunehmen und die Vorteile des Vorhabens klar aufzuzeigen. Die Bruchsaler Oberbürgermeisterin stand von Anfang engagiert hinter den Bemühungen der Energiewende. Nach dem Beschluss des Gemeinderats zur Teilnahme am European Energy Award, werden Energiewendeprojekte auch durch die Mitglieder des Gemeinderats mitgetragen und unterstützt. Aber auch die Bevölkerung muss kontinuierlich in den Prozess integriert und ihre Verunsicherung im Hinblick auf die Energie- und Wärmewende ernst genommen werden. Durch Workshops, kostenlose Energieberatungen und Informationsangebote konnten Fragen und Zweifel sowie der Nutzen der Wärmeprojekte sachlich besprochen werden. So können für potenzielle Kund*innen beispielsweise langfristige Kostenersparnisse vorgerechnet werden. Eine konkrete und seriöse Kommunikation ist während des gesamten Prozesses unerlässlich. Der ausschlaggebende Argumentationspunkt ist schließlich allerdings die Wirtschaftlichkeit eines Projekts. Wärmenetze erfordern hohe Investitionen. Verlässliche Förderprogramme sind daher ebenso entscheidend wie die Erarbeitung einer langfristigen Strategie und die Integration erfahrener und ggf. externer Expert*innen bei der Planung des Wärmenetzes. Aus Kostengründen bietet sich die Kombination mit anderen Infrastrukturprojekten an. Der Erfahrungsaustausch wurde daneben durch einen Expertenbeitrag ergänzt. Die Teilnehmer*innen konnten mit GP Joule, einem Energieversorger, der unter anderem Wärmenetze plant und realisiert, über finanzielle, wirtschaftliche und regulatorische Hürden diskutieren und konkrete Tipps aus der Praxis einholen. Verschiedene Optionen erfolgreich umgesetzter Wärmeprojekte wurden aufgezeigt, zum Beispiel ein Wärmenetz, welches mit einer Großwärmepumpe in Kombination mit einer Photovoltaik-Anlage gespeist und durch einen Wärmepufferspeicher ergänzt wird. Schritt für Schritt konnten die einzelnen Projektschritte nachvollzogen werden: Von der Projektinitiierung zur Kundengewinnung und aktiven Planungsphase bis zur Bauphase und schließlich dem aktiven Betrieb des Wärmenetzes.
Trotz knapper personeller und finanzieller Ressourcen, fühlen sich viele Kommunen ihren Bürger*innen gegenüber verpflichtet, die Energiewende voranzutreiben und somit eine klimafreundliche Zukunft zu gestalten. Der Austausch zeigt, wie wichtig der Dialog zwischen Kommunen ist. Durch Wissenstransfer und das Teilen von Erfahrungswerten können Energiewendeprojekte über kommunale Grenzen hinweg unterstützt, angestoßen und umgesetzt werden.
Interessieren Sie sich in Ihrer Kommune auch für einen Austausch zu Energiewendeprojekten und Sektorenkopplung? Egal ob Sie bereits Erfahrungen gesammelt haben oder sich über mögliche Projekte austauschen möchten – wir organisieren einen kostenlosen, moderierten Austausch mit einer passenden Kommune. Für den Austausch können sich alle Städte, Gemeinden und Landkreise sowie kommunale Unternehmen bewerben. Weitere Informationen zum kommunalen Austausch finden Sie hier. Bei Interesse oder Fragen melden Sie sich gerne unverbindlich bei Sophia Engesser: s.engesser@unendlich-viel-energie.de.
Der kommunale Austausch wurde im Rahmen des Projekts "Forum Synergiewende" durchgeführt. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) gefördert, und von der Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) und der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gemeinsam durchgeführt. Weitere Informationen zum Projekt erhalten Sie hier.

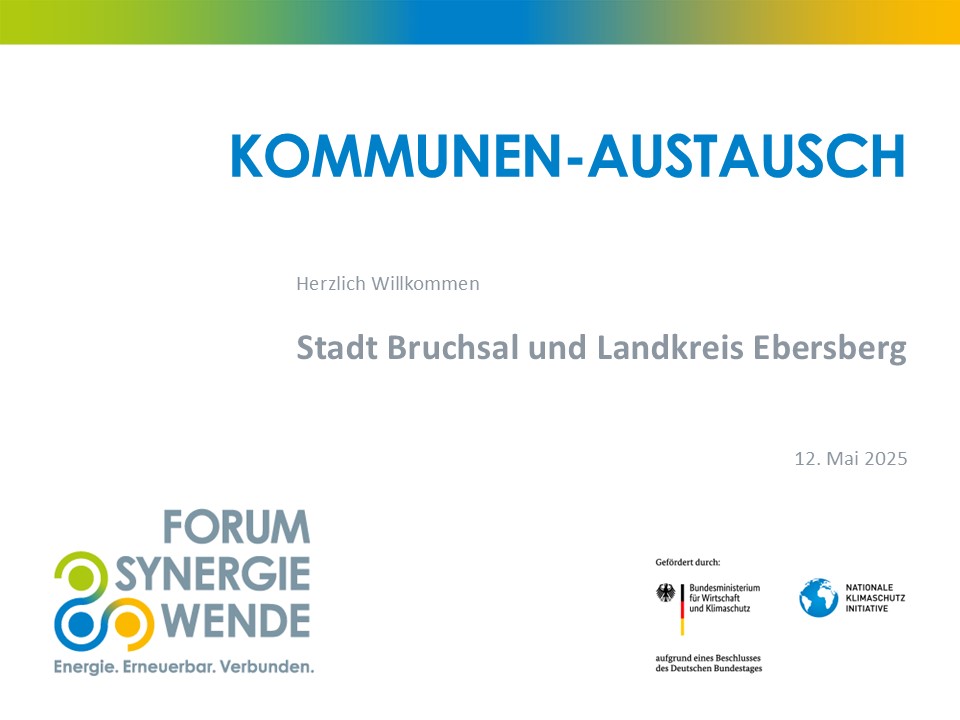
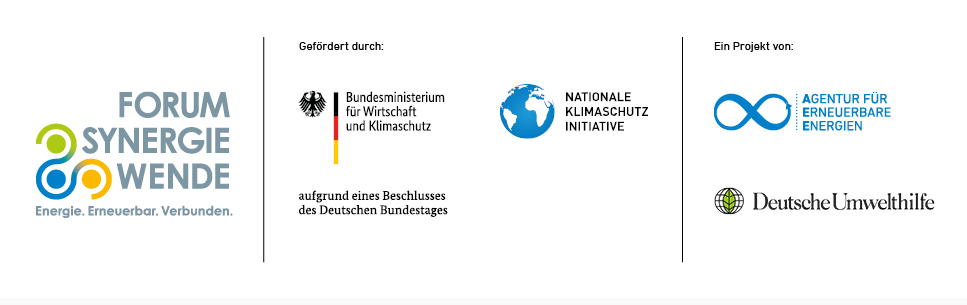
Social Media